BERUFSBILDUNG: Koch ohne Buch - scrollen statt Schmoren. Wie die Berufsbildung das Denken outsourct und die Kochlehre ihr Gedächtnis verliert.
Kochlehrlinge benötigen heute kein Kochbuch mehr. In der Neuen Zürcher Zeitung war folgender Artikel zu lesen: «Junge lesen kaum noch. Die Folgen sind gravierend.» Daraufhin sind wir bei Das Pauli Magazin der Frage bzw. den Studien nachgegangen. Lesen ist ein Akt der Entschlüsselung, der Vorstellungskraft, der geistigen Selbstermächtigung. Doch ist Lesen wirklich unabdingbar für Bildung? Oder nur ein romantisiertes Relikt aus analogen Zeiten? Die Antwort ist klarer und tiefgründiger, als man denkt. Und man staunt. Während Hirnforscher das Denken erforschen, glauben Bildungsexperten, es durch Tools ersetzen zu können – und halten sich dabei offenbar für klüger als das Gehirn selbst. Was nachfolgend aufgearbeitet ist, steht längst bereit — als wissenschaftlich fundiertes Wissen, frei verfügbar im Netz. Doch die paradoxe Pointe: Je leichter der Zugang, desto flüchtiger der Blick. Erkenntnis verlangt Tiefe, nicht nur Zugriff.
____________________________________
Text: Romeo Brodmann | Bilder: Unsplash, Limor Zellermayer
Von Gewürzen bis Sirup auf LEEK.ch
Firmen, die in diesem Verzeichnis nicht aufgelistet sind, haben trotz Aufforderung von einem kostenlosen Basis-Eintrag abgesehen.
LEEK.ch: Die unabhänige Suchplattform ohne Tracking für Gastronomie und Hotellerie von Das Pauli Magazin.
Finden Sie ein Produkt oder ein Unternehmen nicht? Oder finden Sie Ihre eigene Firma nicht? Melden Sie dies bitte via info@leek.ch.
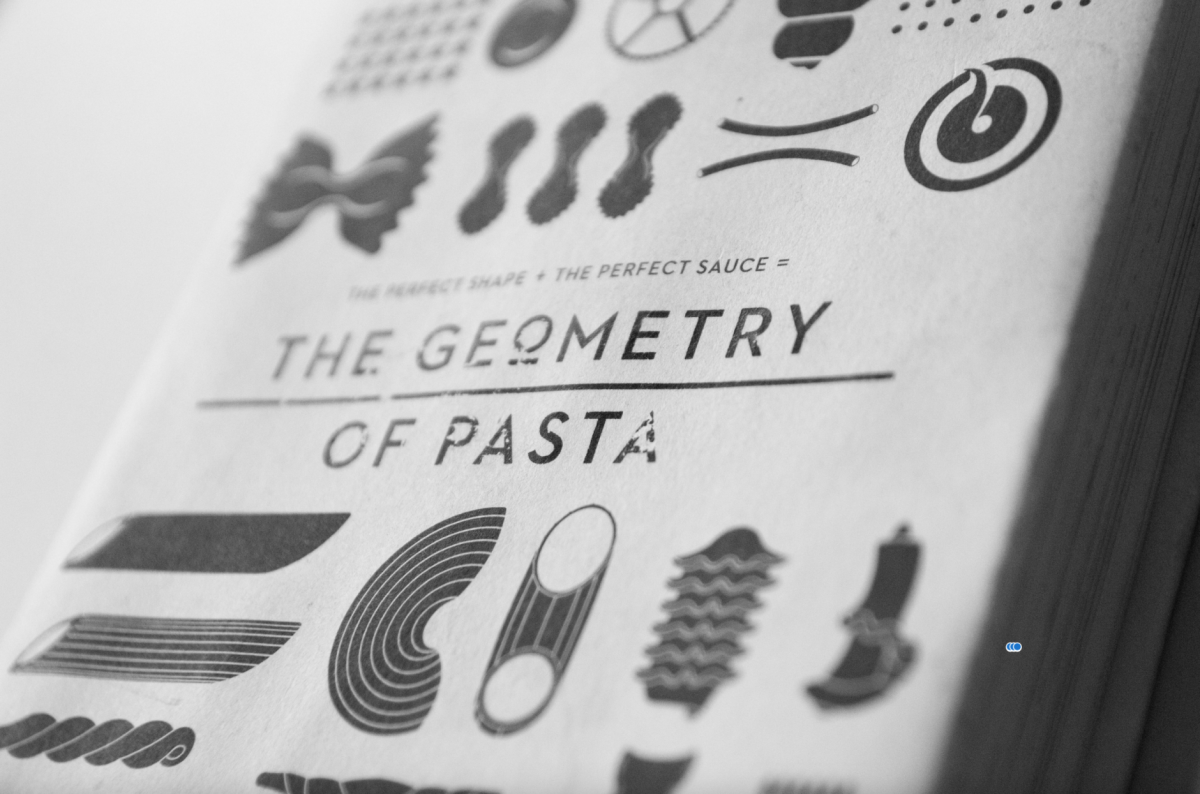
Bilder: Unsplash, Limor Zellermayer
Lesen als Bildungsakt – analog, digital, neuronal
Bildung ist mehr als das Ansammeln von Fakten. Sie ist das Erlernen der und schliesslich die Anwendung der Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, kritisch zu reflektieren, sich selbst und andere zu verstehen. Und Lesen ist das Werkzeug, das diesen inneren Bildungsraum erschliesst. Es ist nicht nur ein Kanal für Information, sondern ebenso ein Katalysator (Beschleuniger) für das Denken.
Forscher vermuten, die Nutzung von KI-Tools führe beim Schreiben zu einer «kognitiven Auslagerung» (Ausgliederung von Gedächnisfunktionen) – also dazu, dass Nutzer weniger selbst denken, was langfristig zu «kognitiven Schulden» führt: geringere Gehirnaktivität, schlechteres Erinnerungsvermögen und reduzierte Eigenverantwortung beim Schreiben.
Das Media Lab des Massachusetts Institute of Technology MIT unter der Leitung von Dr. Nataliya Kosmyna wollte es genau wissen. Die vorangehend angeführte Hypothese wurde mit einer qualitativen Studie unter dem Titel «Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task» untersucht. Die Studie prüfte, wie sich das Schreiben mit Hilfe von KI auf die Gehirnaktivität, das Erinnerungsvermögen und die Qualität von Texten auswirkt – verglichen mit dem Schreiben ohne Hilfsmittel oder mit klassischen Suchmaschinen.
Die Ergebnisse der MIT-Studie zeigt eindrücklich, was passiert, wenn wir das Schreiben – und damit auch das Denken – an KI abgeben: Die neuronale Aktivität nimmt ab, die kognitive Belastung sinkt, aber auch die geistige Eigentümerschaft am Geschriebenen. Wer sich zu sehr auf externe Systeme verlässt, verliert den inneren Muskeltonus des Denkens. Lesen hingegen aktiviert genau diese Netzwerke: Aufmerksamkeit, Gedächtnis, semantische Verarbeitung (Bedeutungsanalyse).
Eine Studie eines Forscherteams der University of Cambridge, University of Warwick und der Fudan University (China) ergänzt dieses Bild: «Early-initiated childhood reading for pleasure: associations with better cognitive performance, mental well-being and brain structure in young adolescence.» Diese Studie untersuchte, wie früh und regelmässig aus Freude gelesenes Lesen in der Kindheit mit besseren kognitiven Leistungen, stabilerer psychischer Gesundheit und positiven Veränderungen der Hirnstruktur im Jugendalter zusammenhängt.
Die Ergebnisse sind heftig: Kinder, die früh und regelmässig lesen, zeigen im Jugendalter nicht nur bessere schulische Leistungen, sondern tatsächlich auch eine stabilere psychische Gesundheit. Zwölf Stunden Lesezeit pro Woche stehen in direktem Zusammenhang mit vergrösserten Hirnregionen für Aufmerksamkeit und Sprachverarbeitung. Lesen formt das Gehirn – strukturell (im Aufbau) und funktional (in der Nutzung).
Doch gilt das auch für das Lesen am Bildschirm? Die Antwort ist differenziert. Digitale Texte können dieselben kognitiven Prozesse aktivieren – vorausgesetzt, sie werden konzentriert und linear gelesen. Studien zeigen jedoch, dass Bildschirmlesen oft fragmentierter, flüchtiger und stärker von Ablenkung geprägt ist. Das Scrollen, Springen und Multitasking reduziert die Tiefe der Verarbeitung. Analoge Texte hingegen fördern die sogenannte Deep Reading-Fähigkeit – ein vertieftes, reflektierendes Lesen, das komplexe Gedanken und Empathie (Einfühlungsvermögen) begünstigt*.
Die Stiftung Lesen bestätigt diese Befunde aus gesellschaftlicher Perspektive: Lesekompetenz ist der Schlüssel zur Teilhabe, zur Selbstbestimmung, zur Bildungskarriere. Wer nicht liest, bleibt abhängig von mündlicher Vermittlung, von Bildern, von Algorithmen. Wer liest, wird zum Autor seines Denkens.
Der Hirnforscher Gerald Hüther bringt es allgemein verständlich auf den Punkt: «Lesen ist wie Dünger für das Gehirn. Es lässt neue Verbindungen wachsen, wo vorher nur brachliegendes Land war.»
Der Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer warnt: «Wer nicht liest, denkt nicht selbst. Er konsumiert Gedanken anderer – ungefiltert, unreflektiert.»
Und Maryanne Wolf, Neurowissenschaftlerin und Leseforscherin, schreibt: «Das Lesen ist eine Erfindung, die das Gehirn verändert hat – es hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.»
Lesen ist also kein nostalgisches Ritual, sondern ein neurokognitiver Akt der Selbstbildung. Es ist das stille Training für komplexes Denken, für Empathie, für Urteilskraft. In einer Welt, die immer lauter, schneller und bildlastiger wird, ist Lesen der stille Widerstand – und zugleich das Fundament jeder echten Bildung. Ob auf Papier oder Bildschirm: Entscheidend ist die Tiefe, nicht das Medium.
Also genau jetzt, wo echtes Lesen wichtig wäre, wird es in der Berufslehre faktisch abgeschafft.
Die Ambivalenz zwischen Tastatur und Tastsinn
Die Schweizer Berufsbildung hat sich deutlich gegen das Lesen und für die Digitalisierung in der Berufslehre entschieden. Das heisst konkret: Haptische Bücher wurden und werden aus Berufschulen verbannt. Das Wissen, so die Annahme, stehe sozusagen ausgelagert online im Netz kostenlos zu Verfügung und könnne dann per Google-Suche und Videoplatformen wie Youtube zusammengetragen werden oder noch schlimmer, Digitale Lernplattformen, die per se über kein eigenes Wissen verfügen, ziehen dieses aus bestehenden Referenzwerken- mitunter unrechtmässig.
Dieser Weg schliesst auch mit ein oder basiert sogar darauf, dass es gemäss den Bildungsverantwortlichen keine Referenz (-werke) mehr braucht, weil deren zusammengetragenes Wissen über Generationen in der Allgemeinheit aufgegangen und scheinbar jetzt für jedermann frei nutzbar ist.
die Verlagerung von Wissen aus greifbaren, kuratierten Werken hin zu flüchtigen, digitalen Fragmenten könnte allerding dramatische Folgen haben. Die epistemische Paradoxie**: Das Netz bietet scheinbar unbegrenzten Zugang zu Wissen, doch gerade diese Entgrenzung verhindert oft die Entstehung von Neuem.
Die Digitalisierung verändert die Berufslehre tiefgreifend. Wo früher Bücher, Lernjournale und handschriftliche Notizen das Lernen prägten, dominieren heute Tablets, Lernplattformen und interaktive Aufgabenformate. Doch was geht dabei verloren – und was wird gewonnen?
Haptische Lehrmittel, also greifbare Bücher, Modelle oder Werkzeuge, fördern nicht nur die Feinmotorik, sondern auch die Gedächtnisleistung. Studien zeigen, dass das physische Blättern, Unterstreichen und Markieren von Texten die räumliche Orientierung im Lernstoff stärkt und das episodische Gedächtnis (Erinnerung an konkrete Lernsituationen) aktiviert. Das Gehirn speichert Inhalte nicht nur semantisch (nach Bedeutung), sondern auch sensorisch – über Berührung, Bewegung und visuelle Struktur.
Digitale Medien hingegen bieten Flexibilität, Aktualität und Interaktivität. Lernplattformen können Inhalte personalisieren, Lernstände erfassen und multimedial aufbereiten. Doch sie fördern oft ein oberflächliches Durchklicken statt tiefes Durchdringen. Lückentext-Aufgaben, so beliebt sie sind, trainieren das Erkennen, nicht das Verstehen. Sie simulieren Kompetenz, ohne sie zu verankern.
Die Your Brain on ChatGPT-Studie liefert hier eine wichtige Parallele: Wenn Lernende sich zu stark auf digitale Hilfen verlassen, sinkt die neuronale Aktivität in den für Problemlösung und Selbstreflexion zuständigen Hirnarealen. Die kognitive Belastung wird zwar reduziert – aber auch die geistige Eigentümerschaft am Gelernten. Das Denken wird ausgelagert, das Lernen entkoppelt vom Körper.
Gerade in der Berufslehre, wo Handwerk, Praxis und Körperwissen zentral sind, ist das problematisch. Wer nur digital lernt, lernt entkörperlicht. Die Verbindung zwischen Kopf und Hand – einst das Herzstück der dualen Ausbildung – wird durch Bildschirminteraktion ersetzt. Das kann zu einer Entfremdung vom eigenen Tun führen.
Witzigerweise torpetiert also die Digitalisierung ausgerechnet das Neue didaktische Leitprinzip und bildungsstrategische Zielkonzept der HANDLUNGSKOMPETENZ, das mit dem Koch 2024 Eingeführt wurde.
Der Hirnforscher Joachim Bauer warnt: «Lernen ist ein sozialer, körperlicher und emotionaler Prozess. Wer nur klickt, statt zu greifen, verliert die Tiefe.»
Und die Bildungsforscherin Gabi Reinmann ergänzt: «Didaktik darf nicht zur Softwarefunktion werden. Bildung braucht Widerstand – auch im Material.»
Das bedeutet nicht, dass digitale Medien per se schädlich sind. Im Gegenteil: Sie können bereichern, wenn sie eingebettet sind in ein didaktisches Konzept, das Körper, Geist und Sozialraum verbindet. Aber sie dürfen haptische Lehrmittel nicht ersetzen, sondern müssen sie ergänzen. Die Berufslehre braucht beides: das Buch und das Byte, die Hand und das Hirn.
Die Selbstabschaffung des Fachlehrers – Convenience als Bildungsrisiko
Was sich derzeit in der Berufslehre abzeichnet, ist also mehr als ein mediendidaktischer Wandel – es ist ein stiller Paradigmenwechsel. Die Fachlehrer, gerade im Kochberuf, nehmen digitale Unterrichtsmittel dankend an. Das Zauberwort heisst Convenience – Bequemlichkeit. Die Unterrichtsvorbereitung wird ausgelagert, die didaktische Verantwortung delegiert, die pädagogische Handschrift verwischt. Lehrmittelunternehmen liefern vorgefertigte Inhalte, Lückentexte, Quizformate und Videolinks – scheinbar effizient, scheinbar modern.
Doch mit dieser Bequemlichkeit geht ein Stück Berufsethos verloren. Denn was passiert, wenn das Wissen nicht mehr vom Lehrenden kommt, sondern aus der Suchmaschine? Wenn Lernende nicht mehr den Meister fragen, sondern den Algorithmus? Wenn die Fachperson zur Moderatorin eines fremdproduzierten Lernfilms wird?
Die Antwort ist ernüchternd: Der Fachlehrer investiert in seine eigene Abschaffung. Nicht aus bösem Willen, sondern aus Überforderung, aus Zeitdruck, aus Systemzwang. Doch die Folgen sind gravierend. Die Autorität des Lehrenden wird untergraben, seine Expertise entwertet, seine Rolle verflacht zur Aufsichtsperson. Die Lernenden spüren das – und wenden sich der Maschine zu.
Die MIT-Studie Your Brain on ChatGPT zeigt, wie schnell kognitive Verantwortung abwandert, wenn KI die Denkarbeit übernimmt. Die neuronale Aktivität sinkt, die Selbstverortung im Lernprozess schwindet.
Und was passiert mit dem Berufsstolz, wenn das Fachwissen nicht mehr verkörpert, sondern verlinkt wird? Wenn das Handwerk nicht mehr gezeigt, sondern gestreamt wird? Wenn die Lehrperson nicht mehr erzählt, sondern klickt?
Der Bildungsforscher Rolf Arnold formuliert es drastisch: «Wer Bildung delegiert, verliert ihre Wirkung. Pädagogik ist kein Download.»
Und der Neurobiologe Gerald Hüther ergänzt: «Menschen lernen nur von Menschen, nicht von Maschinen. Beziehung ist der Boden, auf dem Lernen wächst.»
Die Digitalisierung kann ein Segen sein – wenn sie dem Menschen dient. Aber sie wird zur Gefahr, wenn sie ihn ersetzt. Fachlehrer sind keine Content-Manager. Sie sind Träger von Erfahrung, von Haltung, von Kultur. Wenn sie sich selbst aus dem Spiel nehmen, bleibt nur die Oberfläche. Und die Berufslehre verliert ihren Kern.
Vom Feuer zur Formel – Die stille Umcodierung des Kochberufs
Etwas verändert sich. Nicht laut, nicht abrupt, sondern schleichend, systematisch, fast elegant.
Eine Werbung auf Instagram spricht dazu Bände: Ein junger Koch steht verzweifelt vor seinem misslungenen Gericht – der Geschmack stimmt nicht, die Idee fehlt, die Kompetenz versagt. Doch statt zu reflektieren, zu lernen oder zu verbessern, greift er zur App: Gronda. Ein Klick, ein Sternekoch, ein Rezept – und plötzlich gelingt alles. Was als Erfolgsgeschichte auf Social Media inszeniert wird, ist in Wahrheit ein Lehrstück über den Verlust der Eigenständigkeit. Die App ersetzt das Denken, das Kochbuch wird zur Datenbank, und die Lehre verkommt zur Bedienung. Der Koch wird zum Rezept-Konsument, nicht zum Gestalter. Digitale Tools versprechen Rettung, doch sie entmündigen. Kompetenz wird nicht mehr aufgebaut, sondern gestreamt – und wer nicht schmeckt, muss nicht lernen, sondern nur kopieren.
Der Kochberuf, einst ein Handwerk mit Hitze, Rhythmus und Geruch, wird umcodiert. Die Zutaten sind nicht mehr nur Butter, Mehl und Zeit – sondern Module, Plattformen und Prozessdiagramme. Was früher aus Erfahrung entstand, wird heute aus Templates gezogen. Die Lehrperson wird zur Schnittstelle, der Lernende zum User.
Die Digitalisierung der Berufslehre bringt zweifellos neue Möglichkeiten. Doch sie bringt auch eine neue Sprache, eine neue Logik – und eine neue Identität. Der Koch wird nicht mehr als Könner gedacht, sondern als Koordinator. Nicht mehr als Gastgeber, sondern als Hygieneverantwortlicher. Nicht mehr als Erzähler am Herd, sondern als Datenpunkt im System.
Die Lehrmittel folgen dieser Bewegung. Sie sind glatt, klickbar, effizient. Sie versprechen Entlastung – und liefern Entkopplung. Die Fachlehrperson, einst Trägerin von Wissen und Haltung, lagert ihre Stimme aus. An Lehrmittelverlage, an Videoplattformen, an KI-Systeme. Die Begründung ist nachvollziehbar: Zeitmangel, Systemdruck, Convenience. Doch die Konsequenz ist tiefgreifend. Wer das Erzählen delegiert, verliert das Narrativ. Wer das Denken outsourct, verliert die Autorität.
So entsteht eine paradoxe Situation: Die Fachlehrer investieren – oft unbewusst – in ihre eigene Unsichtbarkeit. Sie werden ersetzt, nicht durch eine Reform, sondern durch eine Routine. Die Lernenden spüren das. Sie lernen nicht mehr vom Menschen, sondern vom Interface. Sie erleben nicht mehr das Handwerk, sondern die Oberfläche seiner Simulation.
Und der Beruf? Er bleibt bestehen – formal, strukturell, zertifiziert. Aber er verändert sein Wesen. Die Umcodierung ist keine Abschaffung, sondern eine Transformation. Vom Feuer zur Formel. Vom Handgriff zur Prozessbeschreibung. Vom Beruf zur Funktion.
Wer das erkennt, muss nicht nostalgisch werden. Aber wach. Denn Berufsausbildung ist mehr als Vermittlung. Sie ist Beziehung, Haltung, Kultur. Und der Kochberuf ist mehr als ein Job – er ist ein Erbe. Wer ihn umcodiert, muss wissen, was er bewahrt, was er verändert, und was er verliert.
_____________________________
Quellen:
Analoge vs. digitale Lektüre – was sagt die Forschung?
Zahlreiche internationale Studien kommen übereinstimmend zum Schluss: Wissen, das aus analogen Büchern aufgenommen wird, wird vom menschlichen Gehirn nachhaltiger verarbeitet, besser verstanden und langfristiger verankert als Wissen, das über digitale Medien vermittelt wird. Umgekehrt zeigen sich beim digitalen Lesen häufig Defizite im Textverständnis, in der Konzentration und in der kognitiven Tiefe der Verarbeitung.
Diese Effekte lassen sich unter anderem auf folgende Faktoren zurückführen:
-
die räumlich-stabile Struktur von Papierseiten (bessere Orientierung und Wiederauffindbarkeit)
-
die geringere Ablenkung durch externe Reize
-
die multisensorische Verarbeitung beim Umblättern, Markieren oder Notieren
-
sowie die tiefere kognitive Verarbeitung durch verlangsamtes, reflektierendes Lesen.
Nachfolgend eine Auswahl renommierter, öffentlich zugänglicher Studien und Metaanalysen, die diese Befunde belegen:
-
Stavanger-Erklärung von E-READ: Zur Zukunft des Lesens
-
Studie enthüllt: Wer viel liest, lebt bis zu zwei Jahre länger
-
LESEN IM 21. JAHRHUNDERT Lesekompetenzen in einer digitalen Welt. Deutschlandspezifische Ergebnisse des PISA-Berichts „21st-century readers“
-
PISA publications
-
The series of reports available on each cycle of PISA's periodic testing program on student performance.
-
Führt Lesefreude zu Lesekompetenz? Empirische Befunde zu unterschiedlichen Ansätzen der Leseförderung
-
Publikationen: Hier finden Sie eine thematisch sortierte Übersicht unserer Artikel und Beiträge in Sammelbänden: Leseförderung / Lesekompetenz / Lesebegriff
-
Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension
-
PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study
-
ERIC - Effekte des Leseunterrichts auf kognitive Teilprozesse des Lesens – Eine computergestützte Untersuchung in der Grundschule
*Studien und Quellen zur Differenz von Bildschirm- und Papierlektüre
-
Stavanger-Erklärung (2019): Eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung von Anne Mangen (Universität Stavanger) warnte vor einer «Verflachung der Lesekultur» durch Bildschirmlektüre. Sie zeigte, dass längere Sachtexte am Bildschirm schlechter verstanden und behalten werden als auf Papier.
-
Cornelia Rosebrock (Goethe-Universität Frankfurt): In ihrem Artikel «Netzlektüre und Deep Reading: Entmischungen der Lesekultur» analysiert sie die kognitiven Unterschiede zwischen informatorischem Bildschirmlesen und immersivem literarischem Lesen. Sie betont, dass Deep Reading – also vertieftes, reflektierendes Lesen – durch digitale Modalitäten erschwert wird.
-
Stefan Aufenanger (Universität Mainz): In seiner Übersicht «Texte lesen: besser analog als digital?» fasst er systematische Reviews zusammen und zeigt, dass digitales Lesen oft fragmentierter ist, während Papierlektüre die Kohärenzbildung und das mentale Modellieren komplexer Inhalte besser unterstützt.
** Was die Forschung zur Episemischen Paradoxie sagt:
-
Byung-Chul Han spricht von der «Informationsflut ohne Bedeutung»: Wissen wird zur Ware, nicht zur Erkenntnis.
-
Neil Postman warnte schon früh vor «Technopoly» – einer Kultur, die Technik über Inhalte stellt.
-
Stiftung Lesen und Bildungsforschung zeigen, dass ohne vertieftes Lesen keine nachhaltige Wissensbildung möglich ist.


