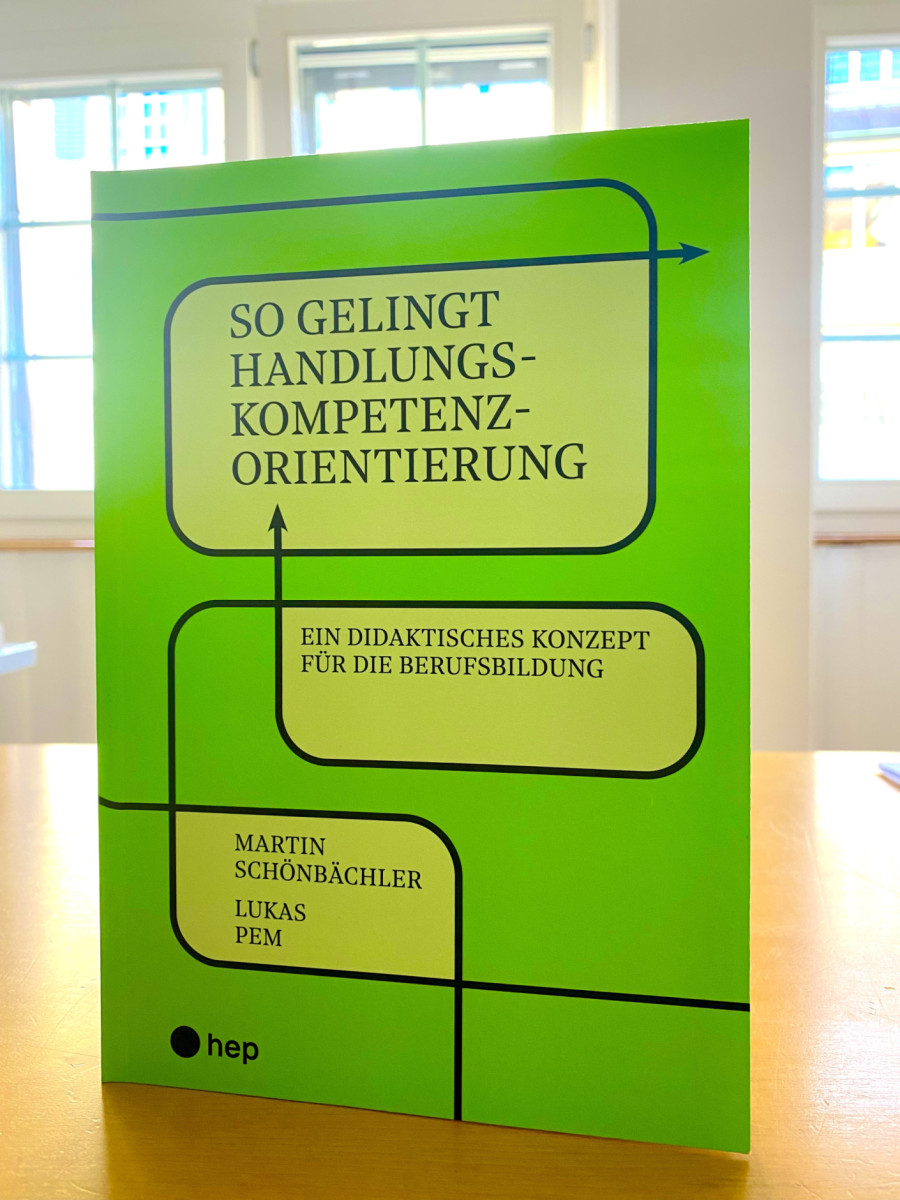
Die «Revision Koch 2022» ist ja beinahe zu einer Art oszillierender Asymtote geworden. Mittlerweile zur «Revision Koch 2024» umbenannt, zittert sich das Unterfangen, unter den Auswirkungen der launenhaften Schwingungen des Eigennutzes gewisser Protagonisten, einem Punkt in der Unendlichkeit zu.
Währenddessen stellt sich bei den Berufsbildenden, also den Praktikerinnen und Praktiker, immer dringlicher die Frage, was jetzt mit des Pudels Kern der Revision, der unabwendbaren Handlungskompetenz, gemeint ist und vor allem, wie das im Alltag zu bewältigen sei. Auf diese Frage geben Martin Schönbächler und Lukas Pem Antworten und Erklärungen und bieten Ansätze zu Lösungen.
Ein praktisches Beispiel, um was es geht, lieferte an der Buchvernissage Lara Cinotti von der berufsbilder.ch AG. Sie betreute einen schulisch schwächeren Lernenden, der für seine 3-jährige EFZ-Lehre (für die es kein EBA gibt) sage und schreibe sieben Jahre benötigte (ein Jahr Vorbereitungspraktikum und jedes Lehrjahr wiederholt). Als sie einstieg, stellte sie fest, dass der junge Mann Theorie und Praxis nicht verbinden konnte. Er fiel in der Theorie durch, bestand aber die praktische Prüfung jeweils mit Bravour, also überdurchschnittlich gut. Und: Er hatte den Willen durchzuhalten – er glaubte daran, dass er es kann und das war die notwendige Voraussetzung, die es brauchte. Die Orientierung an seinen überdurchschnittlichen praktischen Handlungskompetenzen half Lara Cinotti, mit dem Lernenden eine Lernumgebung zu schaffen, in der er die Theorie erfolgreich an seine Kompetenzen in der Praxis knüpfen und verstehen konnte.
Dazu passt der Prolog in Schönbächlers und Pems Buch:
«Lernen strengt an und löst Irritation aus. Die vernetzte Welt und ihre Phänomene bieten uns dabei täglich die Stirn. Unser Handeln und noch mehr unsere Kompetenzen sind herausgefordert. Dies gilt ganz besonders für die Berufsbildung.
Die Berufsbildung ist kein Warteraum auf das Leben. Sie ist das Leben – eben das Berufsleben! Es warten Kunden und Gäste. Versprochene Dienstleistungen müssen erbracht und Produkte hergestellt werden. Mittendrin stehen die Lernenden, Ausbildenden und Lehrenden. Gebildet oder ungebildet. Vielleicht auch mehr oder weniger gebildet.»
Handlungskompetenz? Wie kommt man in der Berufsbildung überhaupt darauf? Das ist eine etwas längere Geschichte, denn es ist nämlich alles andere als einheitlich festgelegt, was der Begriff genau bedeuten soll. Je nachdem wie und wo (Organisations- und Personalentwicklung, Psychologie oder Pädagogik) er gerade gebraucht wird, wandelt sich die Bedeutung. In dieser Erläuterung geht es um die Handlungskompetenz in der Pädagogik.
Als die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD in den 1990er-Jahren die PISA-Studie auf den Weg brachte, wurde ein Begriff bzw. eine Handlungsabsicht ins Zentrum gerückt: Förderung von Kompetenzen.
Die PISA-Studie ist zwar als internationale Schulleistungsuntersuchung ausgelegt, soll aber «…über die Messung von Schulwissen hinausgehen und die Fähigkeit erfassen, bereichsspezifisches Wissen und bereichsspezifische Fertigkeiten zur Bewältigung von authentischen Problemen einzusetzen». (Max Planck Institut)
Die PISA-Studie soll also der Heranbildung von menschlichem Vermögen (Humanvermögen, Humankapitaletc.) zugute kommen, welches die OECD als «…das Wissen, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, (…) die relevant sind für persönliches, soziales und ökonomisches Wohlergehen» (OECD 1999) definierte.
In der Folge der ersten Erhebung im Jahr 2000 wurde in Deutschland die sogenannte «Klieme-Expertise» (Prof. Dr. Eckhard Klieme, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt a.M. | Download hier) erstellt und 2003 veröffentlicht. Diese Expertise bildete die Basis für die Festschreibung der Förderung von Kompetenzen in den Lehrplänen der deutschen Schulbildung im Sinne einer Abkehr von der blossen Wissensvermittlung.
Die heute allgemein akzeptierte Klarlegung von Kompetenzvermittlung ist die des Psychologen F.E. Weinert: «Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.»
Etwas verständlicher ist die Erklärung der Deutschen Kultusministerkonferenz von 2011: «Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.»
Nun, was in der deutschen Grundbildung längst Bestand hatte, fasste Anfang der 2010er Jahre im Eidgenössischen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI Fuss. Fortan sollte die berufliche Grundbildung danach ausgerichtet werden. SBFI: «Handlungskompetenzen verschaffen den Lernenden und den Berufsbildungsverantwortlichen in den drei Lernorten ein klares Bild von den Erwartungen und Anforderungen an eine berufliche Grundbildung. Sie ermöglichen die Vergleichbarkeit und damit die Anerkennug andernorts erworbener Kompetenzen und fördern so Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit.»
Zurück zum Buch «So gelingt Handlungskompetenzorientierung. Ein didaktisches Konzept.» Martin Schönbächler und Lukas Pem knüpfen im Grunde an den letzten Satz der Kultusministerkonferenz an: «Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz.»
Geliefert werden Bausteine zum Einrichten von Arbeitssituationen und Lernumgebungen. Und das Buch ist Anleitung, wie Lernende zum Wollen und zur Selbstständigkeit geführt werden können, denn genau darum geht es. Lernende sollen sich mit den folgenden Fragen auseinandersetzen: (warum) kann ich?, (warum) will ich?, (warum) darf ich? und (was) weiss ich?
Wer also von der Annahme ausgeht, die Orientierung an der Handlungskompetenz sei der Bau eines weiteren Ponyhofes für Lernende, liegt falsch. Die Lernenden werden ihrer eigenen Selbstkompetenz in der Arbeitspraxis ausgesetzt. Dafür werden mit der «Revision Koch 2024» (gegenwärtig) Schule, Theorie und Lückentexte auf vorgefertigten Arbeitsblätter zurückgestuft und dafür das Handwerk, das Wissen aus dem Lehrbuch (also beim Koch der Pauli) und die Verbindung von beidem in der Praxis im Ausbildungsbetrieb wieder in den Vordergrund gerückt. Daran führt kein Weg vorbei. Und wer sich jetzt damit auseinandersetzen will, sollte sich das Buch besorgen. Martin Schönbächler erarbeitete die Theorie, Lukas Pem unterlegte diese aus der Praxis.
Das Buch Hier anschauen und bestellen.
ISBN Print: 978-0355-2178-8
ISBN E-Book: 978-3-0355-2179-5


